Jetzt kostenlos ausprobieren
Kostenlos und unverbindlich 30 Tage lang ausprobieren. Ihre Daten behandeln wir natürlich streng vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter.“
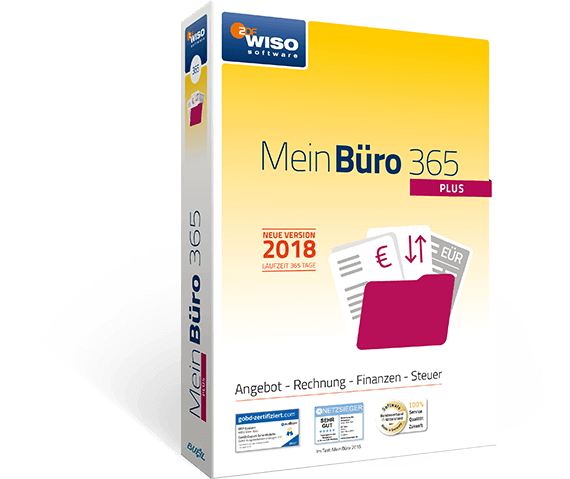
Dank des modularen Aufbaus ist MeinBüro über alle Branchen hinweg im Einsatz. Große und kleine Unternehmen gehören ebenso zu unseren Kunden wie Freiberufler und selbstständige Unternehmer.Machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie MeinBüro auch Ihren Berufsalltag vereinfachen kann!

Das Finanzamt schenkt auch im Advent nichts her. Das bedeutet für Arbeitgeber: Selbst bei betrieblichen Weihnachtsfeiern und ähnlichen Betriebsveranstaltungen kann Lohnsteuer anfallen.
Bei „Weihnachtsfeier“ denken manche Leute an Schneeflocken und Glockenläuten, andere an Shopping-Stress oder „Last Christmas“ in Endlosschleife. Steuerrechtler sehen den § 19 Abs. 1 Nr. 1a EstG vor sich.
Dort finden sich die Regelungen zur Lohnsteuerpflicht durch Betriebsveranstaltungen mit und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die betriebliche Weihnachtsfeier mag das gesamte Team in fröhlicher Atmosphäre zusammenbringen. Das Finanzamt sieht den Anlass trotzdem nüchtern. Bezahlt der Chef den Mitarbeitern eine Party, so die steuerrechtliche Logik, dann ist das grundsätzlich eine Form von Lohn. Deshalb stellt sich die Frage nach der Lohnsteuer.
Allerdings will der Fiskus nicht in jedem Fall Steuern, sobald im Betrieb gefeiert wird. Es gibt Freibeträge. Entscheidend ist, wie teuer die Veranstaltung für das Unternehmen war, wer eingeladen wurde und wie viele mitgefeiert haben.
Sie wollen es ganz genau wissen? Welche Regeln die Finanzverwaltung bei Betriebsveranstaltungen anwendet, fasst ein BMF-Schreiben zusammen (BMF vom 14.10.2015).
Im Gegensatz zur regulären Lohnsteuer nach individuellen Abzugsmerkmalen ist der Arbeitgeber bei pauschaler Lohnsteuer alleiniger Steuerschuldner des Finanzamts.
Es steht ihm aber frei, diese Steuer auf die Mitarbeiter „abzuwälzen“, das heißt den Betrag vom Bruttolohn abzuziehen. Eine besondere Vereinbarung muss er dazu nicht abschließen, da er sich auf § 40 Abs. 3 Satz 2 EstG als Rechtsgrundlage berufen kann.
Beim Umrechnen der Kosten pro Kopf besteht die Finanzverwaltung darauf, dass nur die anwesenden Teilnehmer zählen. Angemeldete Mitarbeiter, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht erschienen sind, dürfen nicht berücksichtigt werden.
In dem dort verhandelten Fall hatte ein Betrieb seine Weihnachtsfeier als gemeinsamen Kochkurs geplant. 27 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatten zugesagt, von denen nur 25 kamen. Der Arbeitgeber musste für das adventliche Kochseminar trotzdem den ursprünglich vereinbarten Preis bezahlen, insgesamt 3.052,35 Euro.
Umlegen durfte er diese Gesamtausgabe bei der Berechnung der Freibeträge nur auf die 25 Anwesenden Für die beiden angemeldeten, aber nicht erschienenen Mitarbeiter gab es keinen Freibetrag, obwohl für sie mitbezahlt wurde. Diese Auffassung des Finanzamts hat der Bundesfinanzhof als oberstes deutsches Steuergericht bestätigt (BFH, 29. April 2021, VI R 31/18).
Die Mitarbeiter können zur Weihnachtsfeier jemand mitbringen? Dann werden die Kosten, die auf die Begleitpersonen entfallen, den dazugehörigen Betriebsangehörigen zugeschlagen. Trotzdem bleibt es beim Freibetrag von 110 Euro.
Die Wahrscheinlichkeit, diesen Betrag zu überschreiten, steigt also, wenn die Beschäftigten eine oder sogar mehrere Personen mitbringen dürfen.
Angenommen, die Firma Rentier-Schlittentransporte GmbH veranstaltet eine üppige Weihnachtsfeier für ihre 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 110 von ihnen sagen zu und werden beim Event-Service angemeldet. Allerdings geht ein grippaler Infekt um. So kommen nur 100 Beschäftigte tatsächlich zur Feier.
Von diesen 100 bringen 25 ihren Partner oder die Partnerin mit. Damit kommen 125 Teilnehmende zusammen.
Die Kosten der Veranstaltung – edle Location, großes Büffet, Freigetränke und umfangreiches Unterhaltungsprogramm – belaufen sich einschließlich Umsatzsteuer auf 15.250 Euro.
Die fällige Lohnsteuer ermittelt sich wie folgt:
Wenn der Arbeitgeber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas schenkt, dann gelten dafür eigene steuerliche Regeln. Allerdings fließen Geschenke, die im Rahmen einer betrieblichen Feier verteilt werden, grundsätzlich in den Aufwand der Feier mit ein und können in deren Rahmen mitversteuert werden. Solange der Wert der Geschenke 60 Euro pro Mitarbeiter nicht überschreitet, ist das in der Regel kein Problem: Es wird nicht beanstandet, dass dieser Aufwand als Teil der Kosten des Fests betrachtet wird.
Liegt der Wert darüber, nimmt es die Finanzverwaltung genauer: Dann unterscheidet sie Geschenke, die „anlässlich“ der Feier erfolgen, von solchen, die nur „bei Gelegenheit“ der Veranstaltung überreicht werden. Im zweiten Fall greifen die allgemeinen Regeln für Geschenke an Arbeitnehmer (grundsätzlich: pauschale Lohnsteuer in Höhe von 30 Prozent des Werts, § 37b EstG).
Die Nichtbeanstandungsregel bei Geschenken mit einem Wert bis 60 Euro ergibt sich aus einem BMF-Schreiben (BMF v. 07.12.2016, dort „zu Punkt 2“).
Mit der pauschalen Versteuerung des geldwerten Vorteils durch eine Betriebsveranstaltung dürfen Arbeitgeber nicht zu lange warten. Die Lohnsteuer-Anmeldung zur Weihnachtsfeier sollte gleich für den entsprechenden Lohnabrechnungs-Zeitraum erfolgen, allerspätestens bis zur Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung zu Ende Februar des Folgejahrs.
Verzögerungen können teuer werden: Dann droht der Verlust der Sozialversicherungsfreiheit. Das musste eine GmbH erfahren, die ein Firmenjubiläum im September feierte. Die Feier wurde jedoch erst im folgenden März bei der Lohnsteuer-Anmeldung berücksichtigt. Das war zu spät für die Sozialversicherungsträger: sie forderten die Nachzahlung von Beiträgen zur Sozialversicherung. Zurecht, befand das Bundessozialgericht. Das Unternehmen hätte die Pauschalversteuerung schon mit der Lohnsteuer-Anmeldung für September erklären müssen (BSG, 23.04.2024 – B 12 BA 3/22 R).
Bestimmte Unternehmen sind am Ende des Geschäftsjahrs zu einer Inventur verpflichtet. Ziel ist die genaue Bestandsaufnahme des Betriebsvermögens. Soweit sich die Werte nicht aus den Büchern ergeben, werden Waren, Produkte und Investitionsgüter gezählt, gewogen oder gemessen. Eine Inventur kann viel Aufwand und eine ärgerliche Unterbrechung des Betriebs bedeuten. Moderne Geschäftssoftware begrenzt den Arbeits- und Zeitaufwand.
Einmal im Jahr müssen Unternehmen für die Steuer einen Jahresabschluss machen. Für bestimmte Unternehmen ist dazu eine Inventur notwendig.
„Inventur“ nennt man die Bestandsaufnahme, durch die ein „Inventar“ erstellt wird. So bezeichnet das Handelsgesetzbuch die genaue Aufstellung des gesamten Betriebsvermögens eines Unternehmens (§ 240 HGB). Bei der Inventur sind sämtliche Vermögensgegenstände zu ermitteln und zu bewerten, ebenso die Bargeld- und Konto-Bestände und sämtliche Forderungen, die gegen das Unternehmen bestehen.
Viele der für das Inventar erforderlichen Beträge und Zahlen ergeben sich aus den Unterlagen der Buchführung. Anderes muss gezählt, gemessen, gewogen oder geschätzt werden. Das betrifft grundsätzlich auch die Warenbestände im Einzelhandel. Deshalb findet man rund um Sylvester noch immer an vielen Ladentüren den Hinweis „Wegen Inventur geschlossen“.
Allerdings werden solche Schilder seltener. Das liegt daran, dass sich die Betriebsunterbrechung zu Inventurzwecken deutlich verringern oder sogar ganz vermeiden lässt. Voraussetzung ist eine gut geführte Buchhaltung samt Warenwirtschaft (ERP). Außerdem sollte man die Alternativen zur klassischen „Zähl- und Wiege-Inventur“ kennen.
Zur Inventur verpflichtet sind alle Unternehmen und Selbstständigen, die doppelte Buchführung betreiben und eine Bilanz erstellen müssen:
Entscheidend sind also Unternehmensgröße und Rechtsform. Selbstständige und Unternehmen, die nur eine Einnahme-Überschuss-Rechnung erstellen müssen, sind von der Inventurpflicht befreit. Dazu gehören sämtliche freiberufliche Selbstständige.
Rechtliche Grundlage der Inventurpflicht ist § 240 HGB in Verbindung mit § 141 AO.
Der Begriff der „Vermögensgegenstände“, die für das Inventar erfasst werden, bezieht sich im Handelsrecht nicht nur auf Dingen zum Anfassen. Auch immaterielle Werte wie Rechte oder Forderungen fallen darunter, genau wie Immobilien und liquide Mittel.
Zur Inventur gibt es zwei unterschiedliche methodische Ansätze. Welcher von beiden passt, hängt von den jeweiligen Vermögenswerten und von der betrieblichen Organisation ab:
Das Handelsgesetz sieht zusätzliche Möglichkeiten vor, um den Unternehmen die Inventurpraxis zu erleichtern.
Stichprobeninventur, die Verschiebung des Inventur-Stichtags und permanente Inventur müssen vom Finanzamt genehmigt werden.
Bei Stichproben- und laufender Inventur besteht wie bei der Buchinventur das Problem, das Über- und Fehlbestände nicht offengelegt werden. Ein Vorteil der körperlichen Inventur liegt darin, dass sie Diskrepanzen aufdeckt, die durch Diebstahl, Dokumentations- und Übermittlungsfehler oder Beschädigungen entstehen.
Deshalb ist es möglicherweise trotz des größeren Aufwands sinnvoll, Dinge körperlich nachzuzählen: in der Warenwirtschaft mengenmäßig erfasste Produktvorräte, in den Büchern verzeichnete Anlagegüter wie Maschinen und Werkzeuge oder auch Kassenbestände. Nicht selten ergeben sich überraschende Abweichungen.
Eine professionelle Warenwirtschaft erleichtert die Inventur enorm. Tipps dazu liefert „Effiziente Warenwirtschaft: Wie Sie Ihren Lagerbestand im Griff behalten und rechtliche Stolpersteine vermeiden“.
Professionelle ERP-Lösungen bietet die Buhl-Lösungen Unternehmer 365 Professional. Anlagenbuchhaltung ist Teil von Buchhaltung 365 Professional.
Grundsätzlich muss das Inventar jeden Vermögensgegenstand mit Art, Menge und Wert einzeln auflisten. Gleiches gilt für Forderungen. Zusammengefasst werden dürfen „gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens“ – also beispielsweise alle Rohlinge eines Typs, ebenso „andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände“. Auch gleichartige Schulden können zusammengefasst werden. (§ 240 Abs. 4 HGB).
Eine bestimmte Form ist nicht vorgeschrieben. Allerdings sollten Inventurlisten neben den Angaben zu Art oder Typ, Menge oder Anzahl sowie dem Wert der erfassten Vermögensgegenstände stets auch Angaben zum Datum und den Namen der an der Erfassung und/oder Kontrolle beteiligten Personen enthalten. Ob man das Inventar auf Papier, mit digitalen Hilfsmitteln wie Excel oder mit einer professionellen Inventar-Software erstellt, hängt von der Größe des Unternehmens, der Art und Menge der Vermögensgegenstände und den eigenen Präferenzen ab.
Übrigens: Für Inventare gilt eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren (§ 257 Abs. 1 HGB). Das schließt Inventurlisten, Protokolle und andere Begleitdokumente ein. Die digitale Archivierung ist zulässig.
Wer trotz Inventurpflicht keine Inventur durchführt, muss damit rechnen, Ärger mit dem Finanzamt zu bekommen. Schließlich beruhen dann der Jahresabschluss und somit die Steuererklärung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer auf Zahlen ohne Grundlage. Das kann zu einer Schätzung der Steuerlast führen – was sich kaum zugunsten des Unternehmens auswirkt.
Schlimmstenfalls kann eine versäumte oder fingierte Inventur zu strafrechtlichen Problemen führen. Das Ergebnis kann eine Anklage wegen Steuerhinterziehung oder Steuerverkürzung, wegen Betrugs im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen oder wegen Bankrotts („Insolvenzbetrug“) sein.
Einführung der E-Rechnung: das gilt für Verträge und Dauerrechnungen
Die Einführung der E-Rechnungspflicht betrifft auch Mietverträge, Wartungsverträge und andere sogenannte Dauerschuldverhältnisse. Lesen Sie, was in Zukunft bei Dauerrechnungen über wiederkehrende Zahlungen erforderlich ist.
Ausführliche Informationen zur E-Rechnungspflicht allgemein lesen Sie in unserem Beitrag „Ab 2025 kommt die E-Rechnung: Was zu tun ist“.
Mit Dauerschuldverhältnissen sind Vereinbarungen gemeint, die eine kontinuierliche Dienstleistung oder Lieferung betreffen. Beispiele dafür sind:
Typisch für solche Vertragsverhältnisse ist, dass die Abrechnung in regelmäßigen Zeitabständen erfolgt, zum Beispiel monatlich, quartalsweise oder jährlich. Oft verlängern sie sich automatisch, oder sind mit unbegrenzter Laufzeit abgeschlossen, so dass sie erst durch eine Kündigung beendet werden. Das muss allerdings nicht der Fall sein.
Wie bei einmaligen Geschäften sind die fortlaufenden Dienstleistungen oder kontinuierlichen Lieferungen in den meisten Fällen umsatzsteuerpflichtig. Wenn der pro Zahlungsintervall anfallend Betrag gleichbleibt, muss nicht für jeden Zahlungszeitraum eine eigene Rechnung gestellt werden.
Stattdessen kann der Vertrag als Dauerrechnung fungieren, wenn er alle Informationen enthält, die § 14 UStG als Pflichtangaben auf Rechnungen vorsieht, wie Name und Sitz beider Vertragsparteien, die Rechnungsnummer oder USt-IDNr. des Ausstellers, die Höhe des Zahlbetrags netto und brutto sowie Angaben zur Umsatzsteuer. Enthält der Vertrag über das „Dauerschuldverhältnis“ diese Angaben, wird eine monatliche, quartalsweise oder jährliche Rechnung zu jeder Zahlung überflüssig.
Stattdessen belegen der Vermieter oder das Entsorgungsunternehmen mit dem Vertrag als Dauerrechnung, warum sie wiederkehrend einen bestimmten Betrag als Umsatzsteueranteil an der Miete bzw. Entsorgungsgebühr eingezogen haben. Der Mieter oder Kunde untermauert damit bei Bedarf seinen Anspruch auf die Vorsteuererstattung dieser Beträge.
So war zumindest die Rechtslage bisher. Mit der Einführung der E-Rechnung gelten in Zukunft jedoch Besonderheiten.
Ab 2027 muss in den geschilderten Fällen, in denen ein Vertrag als Dauerrechnung fungiert, einmalig eine E-Rechnung erstellt werden, und zwar für den ersten Monat, das erste Quartal oder den sonstigen Teilleistungszeitraum. So sieht es das BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2024 in Abschnitt 3.3 vor. Dieses Dokument fasst Verwaltungsanweisungen zur E-Rechnung für die Finanzämter zusammen.
Dank der E-Rechnung werden die umsatzsteuerlichen Gegebenheiten für das Finanzamt digital erfassbar. Dazu muss der Vertrag, der die Rechnungspflichtangaben enthält, als Anhang in die E-Rechnung eingebunden werden, oder es muss sich auf andere Art klar ergeben, dass eine Dauerrechnung vorliegt.
Bei Änderungen im Vertragsverhältnis, die sich auf die Rechnungspflichtangaben beziehen, muss erneut eine einmalige E-Rechnung ausgestellt werden. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn sich Preise, Stundensätze oder Honorare ändern, einer der Vertragspartner umzieht oder die Dienstleistung wechselt.
Die Regelung gilt nur für Verträge, die ab dem 01. Januar 2027 neu abgeschlossen werden. Für Dauerschuldverhältnissen wie Mietverträgen oder Lizenzverträgen, die die bereits jetzt laufen oder bis zu diesem Zeitpunkt neu abgeschlossen werden, muss keine E-Rechnung erstellt werden.
Manchmal wird das falsch dargestellt. Im Entwurf zu dem erwähnten BMF-Schreiben war als Stichtag noch der 01. Januar 2025 vorgesehen. Wäre dies so beschlossen worden, hätte in vielen Fällen schon recht bald zu Gewerbemietverträgen, Wartungsverträgen und ähnlichem mehr E-Rechnungen verschickt werden müssen. Doch dieser frühe Termin ist nun vom Tisch.
Viele Umsätze sind generell von der E-Rechnungspflicht ausgenommen. Dann entfällt auch die Pflicht zur einmaligen E-Rechnungsstellung bei Dauerschuldverhältnissen. Das gilt für:
Außerdem gelten für die Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen Übergangsregelungen. Zwei davon gelten bis zum Ablauf des Kalenderjahrs 2027. Sie betreffen damit auch den Fall von Verträgen als Dauerrechnung.
Wie immer, so gilt auch für Unklarheiten zur E-Rechnung bei Dauerschuldverhältnissen: Fragen zum konkreten Einzelfall stellen Sie am besten Ihrer Steuerberaterin oder ihrem Steuerberater.

Testphase endet automatisch - keine Kündigung nötig.
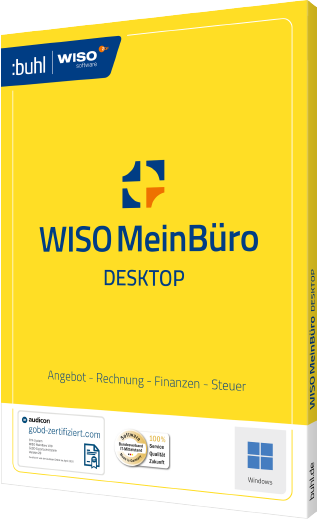
Testphase endet automatisch - keine Kündigung nötig.
Beide Produkte sind nicht miteinander kompatibel.